
Über uns
ADS(H)
Forumsarchiv
Chat
RLS
Geschichten, Märchen
Lieder
Gästebuch
Was ist Neu?
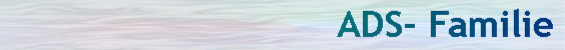
| impressum | home | ads-familie | sitemap
Neurobiologische Erkenntnisse helfen beim Umgang mit LRS:
Das Gehirn lernt immer
Stellen Sie sich vor, Sie wollten einen Motor reparieren oder einfach
nur vernünftig Auto fahren. Dann wäre es gut, wenn Sie über
Motoren Bescheid
wüssten. Sie würden Kavalierstarts im Winter bei kaltem Motor
vermeiden und
wüssten, wo eine Reparatur zu erfolgen hat. Oder stellen Sie sich
vor, Sie sind
Krankengymnastin. Dann nützt es Ihnen sehr viel, wenn Sie von Bändern,
Muskeln und Knochen etwas verstehen. Nicht anders ist das mit dem Lernen
und dem Gehirn. Nur wer weiß, wie das Gehirn funktioniert, kann
letztlich auch gut unterrichten. Dies trifft für den Erwerb der Muttersprache
ebenso zu wie für das Lesenlernen oder das Erlernen höherer
Mathematik.
Die wichtigste Einsicht der Gehirnforschung sei hier gleich als erste genannt: Das Gehirn lernt immer. Und es kann eines nicht: Nicht lernen! Wie der Flügel zum Fliegen, die Flosse zum Schwimmen, das Auge zum Sehen oder der Darm zum Verdauen, so ist das Gehirn zum Lernen entstanden, und kann daher gar nicht anders, als ständig lernen. Hierzu besitzt es eine ganze Reihe erstaunlicher und von der Gehirnforschung der vergangenen Jahre zunehmend aufgeklärter Strukturen, Prozesse und Mechanismen. Und mit diesen geht es uns nicht anders wie mit einem Motor oder einer Kuckucksuhr: Wenn man weiß, wie die Dinge funktionieren, kann man richtig mit ihnen umgehen (sie tun das, was sie sollen und gehen seltener kaputt) und man kann sie zudem besser reparieren, wenn sie einmal ihren Dienst aufgeben. Früher konnte man Lernvorgänge nur mit psychologischen Methoden erfassen und beschreiben. Heute wissen wir, dass sich das Gehirn mit jedem Lernvorgang ändert. Lernen heißt, dass Verbindungen zwischen Nervenzellen geknüpft werden, so dass aus flüchtigen Empfindungen stabile innere Repräsentationen äußerer Gegebenheiten werden. Unser Gehirn produziert durch die Erfahrung, die jeder Einzelne von uns macht, jeweils seine Version von Welt und Realität. Man bezeichnet diese Prozesse insgesamt mit dem Begriff der Neuroplastizität.
Die Großhirnrinde (der Neokortex) besitzt eine ganz bestimmte innere Struktur und Funktionsweise, weswegen sie gar nicht anders kann, als Repräsentationen von sie erreichenden Eingangssignalen zu bilden. Damit ist gemeint, dass Neuronen des Kortex immer dann aktiviert werden, wenn ein ganz bestimmter Input an den Sinnesorganen registriert wird. Neuronen, die auf ähnlichen Input ansprechen, liegen nicht irgendwie verteilt in dem etwa einen viertel Quadratmeter ausgedehnten und fünf Millimeter dicken Geflecht aus etwa zwanzig Milliarden Neuronen. Im Kortex liegt vielmehr ein hohes Maß an Ordnung vor. Diese Ordnung ist das Ergebnis der Wechselwirkung bestimmter Struktur- und Funktionsprinzipien des Kortex einerseits und der Lebenserfahr ung des Individuums andererseits. Es gehört zu den bedeutendsten Leistungen der Neurobiologie der vergangenen 15 Jahre, dass man einige der Prinzipien, die hier am Werke sind, begonnen hat zu verstehen.
Landkarte im Gehirn
Repräsentationen sind im Kortex landkartenförmig strukturiert. Damit ist gemeint, dass sie in ganz bestimmter Weise geordnet sind:
- Ähnliche Signale liegen nahe beieinander.
- Häufige Eingangssignale nehmen einen größeren Raum ein als seltene.
Diese Ordnungsprinzipien kortikaler Repräsentationen – Ähnlichkeit und Häufigkeit – sind von sehr allgemeiner Natur. Durch Computersimulationen lässt sich zeigen, dass solche Karten ganz von allein dadurch entstehen, das neuronale Netzwerke bestimmten Typs Muster verarbeiten. Wichtig ist, dass diese Netzwerke ganz einfach gebaut sind und nur auf drei Funktionsprinzipien beruhen:
- Synapsen sind plastisch,
- im Gehirn herrscht hohe Konnektivität und
- Neuronen sind mit ihren Nachbarn auf ganz bestimmte Weise verbunden, die dafür sorgt, dass bei Erregung an einer Stelle die nahe gelegenen Zellen mit erregt werden, weiter entfernt liegende Zellen hingegen aktiv gehemmt werden (Center-Surround-Prinzip).
Sobald man diese drei Prinzipien, von denen man weiß, dass sie
in der Gehirnrinde implementiert sind, in ein Modell hineinsteckt und
dieses Netzwerk dann mit irgendwelchem strukturierten Input füttert,
entstehen Karten des Input, das bedeutet, aus flüchtigen Aktivitätsmustern
(Input) werden neuronale Repräsentationen dieser Muster (in Form
unterschiedlich starker Synapsen an Neuronen der Output-Schicht des Netzwerks).
Es ist damit nicht gesagt, dass der Kortex auf genau die gleiche Weise
funktioniert wie die Modelle. Wichtig ist vielmehr Folgendes: Die Modelle
zeigen, dass es gar nicht viel – lediglich der Verarbeitung des Inputs
nach den drei Funktionsprinzipien – bedarf, damit Karten entstehen.
Wo diese Prinzipien vorhanden sind (und das ist der gesamte Neokortex),
entstehen Karten. Daher hat man allen Grund zur Annahme, dass neben den
bekannten, kartenförmig strukturierten niederen kortikalen Arealen
auch höherstufige Areale Repräsentationen in Form von Landkarten
enthalten. Dafür sprechen zudem neuere empirische Befunde aus dem
Bereich der multimodalen funktionellen Bildgebng. Kartenförmige Repräsentationen
sind für eine ganze Reihe primärer und sekundärer sensorischer
Areale nachgewiesen: Der somatosensorische Kortex ist, wie bereits erwähnt,
eine somatotope Karte. Im primären Hörkortex befindet sich eine
so genannte tonotope Karte, auf der die vom Ohr kommenden Signale nach
ihrer Frequenz angeordnet repräsentiert werden. Der primäre
visuelle Kortex ist eine retinotope Karte, das heißt jedem Ort dieses
Stücks Gehirnrinde ist ein Ort auf der Netzhaut zugeordnet. Auch
für weitere visuelle Verarbeitungsareale wurde die Kartenstruktur
mittlerweile eindeutig nachgewiesen. Je höher jedoch die Verarbeitungsstufe
ist, desto schwieriger ist dieser Nachweis. Die genannten Karten entstehen
nicht nur dadurch, dass der Organismus sich mit der Welt auseinander setzt,
dadurch Input erhält, und diesen (flüchtigen) Input auf sich
in Form von Synopsenstärken (mehr oder weniger) fest abbildet. Sie
ändern sich auch zeitlebens durch weitere Erfahrung, wenn auch das
Ausmaß der möglichen Veränderung mit zunehmendem Alter
abnimmt.
Veränderungen durch Übung
Zu den eindruckvollsten Demonstrationen von kortikaler Neuroplastizität beim Menschen gehören die Befunde, dass beim Erlernen der Blindenschrift das den rechten Zeigefinger im linken somatosensorischen Kortex repräsentierende Areal messbar größer wird, sowie der Befund, dass Gitarren- und Geigenspieler, die mit den Fingern der linken Hand besonders feinsensorisch diskriminieren müssen, im rechten somatosensorischen Kortex mehr Platz für eben diese Finger aufweisen.
Weiterhin wurde nachgewiesen, dass die akustische Landkarte bei Musikern größer ist als bei Nichtmusikern und Trompeter mehr Platz für Trompetentöne haben, Geiger dagegen mehr Platz für Geigentöne.
Selektives Lernen
Ein wichtiger Gesichtspunkt ist in diesem Zusammenhang, dass Menschen
unterschiedlich lernen – also entsprechend ihren Vorerfahrungen andere
Aspekte der Umgebung für wichtig halten und diese besser verarbeiten.
Da das Ausmaß des Lernens von der Wichtigkeit des Inputs abhängt,
ist dies nicht zu unterschätzen. Zudem ist die Lernrate altersabhängig:
Ältere Menschen lernen langsamer als jüngere. Sie brauchen auch
nicht so schnell zu lernen, denn
sie haben ja schon sehr viel gelernt.
Im Hinblick auf die Fähigkeit des Lesens und Lesenlernens ist zunächst Folgendes von Bedeutung: Das menschliche Gehirn ist nicht zum Lesen gebaut. Es entstand lange Zeit vor der Erfindung der Schrift und aufgrund von Lebensbedingungen, die mit den heutigen wenig gemeinsam haben. Eines zeichnete diese Lebensbedingungen ganz gewiss nicht aus: Schrift auf Schritt und Tritt. Wer liest, der missbraucht also zunächst einmal seinen Wahrnehmungsapparat für eine nicht artgerechte Tätigkeit, etwa wie ein Fliesenleger seine Knie missbraucht, um in Bädern herumzukriechen oder wie ein Te nnisspieler, der seinem Ellenbogen das Aufnehmen von mehr Kräften zumutet, als dieser verkraften kann. Noch einmal anders ausgedrückt: Das Gehirn verhält sich zum Lesen wie ein Traktor zu einem Formel-1-Rennwagen, für dessen Tuning man kurz vor dem Rennen zwei Stunden Zeit bekommt.
Lesen wird uns nicht in die Wiege gelegt
Dass das Lesen bei den meisten Menschen so reibungslos klappt, ist das Resultat Tausender Stunden Übung und zeigt einmal mehr, wie flexibel das menschliche Gehirn ist. Es kann Tätigkeiten lernen, die ihm nicht in die Wiege gelegt sind. Lesen ist ein Spezialfall der visuellen Wahrnehmung. Es ist gelernt und kulturell geprägt, gleichzeitig jedoch so elementar, dass wir gar nicht anders können als ein Wort zu lesen, wenn wir es betrachten. Anders gesagt: Wer Lesen gelernt hat, der kann eines nicht mehr: ein Wort betrachten und es nicht lesen!
Wer täglich etwa zehn Seiten liest, hat in zehn Jahren etwa einhundert
Millionen
Buchstaben wahrgenommen. Diese Buchstaben sind zwar Kunstproduk-te, weil
sie aber zu unseren häufigsten Wahrnehmungsobjekten gehören,
führen sie seit der Erfindung der Schrift ein Eigenleben.
Erst seitdem es Schrift gibt, muss das Sehen mit dem Sprechen verbunden
werden, um den Prozess des Lesens – besonders beim lauten Vorlesen
– rasch und mühelos zu gewährleisten. Wie geschieht nun
diese Umformung von Grafik in Symbolik, von Buchstaben in Bedeutungen,
von geschriebenen Wärtern in gesprochene Laute? Wie genau ist das
Sprachverstehen dem Wahrnehmen aufgepfropft, um das rasche Aufnehmen sprachlicher
Information über den zunächst hierfür nicht konstruierten
Kanal zu gewährleisten?
Die Neurobiologie hat heute sehr differenzierte Antworten auf diese Fragen,
die sich auch dafür eignen, die Probleme beim Erlernen des Lesens
anzupacken.
Akustisches Sprachverständnis
Betrachten wir hierzu ein Beispiel: Fünf bis acht Prozent aller
Kinder leiden nach
Schätzungen amerikanischer Wissenschaftler unter akustischen Sprachverständnisstörungen.
Die Kinder können „pa“ von „ba“, „ti“
von „di“ oder „go“ von „ko“ nicht unterscheiden.
Später entwickeln sie eine Lese- und Schreibstörung. Diese Kinder
haben eine etwas langsame akustische Signalverarbeitung, was oft nicht
bemerkt wird. Die beiden Silben „ba“ und „pa“ beispielsweise
unterscheiden sich nur durch wenige Millisekunden. Können die kurzen
Konsonanten nicht rasch analysiert werden, so ist dies gleichbedeutend
damit, dass das Kind massive Verständnisschwierigkeiten aufweist.
Man kann sich leicht vorstellen, was geschieht, wenn das Problem unerkannt
bleibt: Da das Kind ja „nicht taub ist“, wird ihm nicht selten
böser Wille oder Nachlässigkeit unterstellt werden (mit all
den Konsequenzen, die ich hier nicht ausmalen möchte), wo doch eigentlich
nichts weiter als ein Fehler auf einer frühen Stufe der Inputverarbeitung
bei Sprachsignalen vorliegt. „Früh“, weil es hier nicht
um „Verständnisprozesse“ geht, also nicht um Denk- oder
geistige Leistungen, sondern schlicht um die Analyse von raschen Lautfolgen.
Inzwischen konnte nachgewiesen werden, dass sich das Gehirn auch in dieser
Hinsicht trainieren lässt. Das Training erfolgte unter anderem auch
dadurch, dass die Kinder am Computer immer raschere zeitliche Muster spielerisch
unterscheiden lernen mussten. Nach nur vier Wochen hatten die Kinder nicht
nur gelernt, die neuen Trainingsmuster gut zu verarbeiten, sondern wiesen
auch deutliche Verbesserungen ihrer Fähigkeit zum Verstehen normaler
Sprache auf.
Es kommt bei diesem Beispiel besonders darauf an, sich zu vergegenwärtigen,
dass das neurobiologische Verständnis von Umbauvorgängen im
Gehirn eine rein psychologische Therapie motiviert hat. Das Beispiel verdeutlicht
somit, wie nutzlos die alten „Grabenkämpfe“ sind –
zwischen denen, die glauben, nur biologische Therapie sei sinnvoll zur
Behandlung psychischer Störungen, und denen, die glauben, psychische
Störungen könnten nur durch psychologische Therapieverfahren
angegangen werden. Nichts davon ist richtig! Gehirn und Geist sind innig
miteinander verwoben. Das Lernen zeigt dies so deutlich wie vielleicht
kein anderer Sachverhalt.
Manfred Spitzer
Prof.DDr. Manfred Spitzer studierte Medizin, Psychologie und Philosophie,
war zweimal
Gastprofessor an der Harvard-Universität und ist Leiter der Psychiatrischen
Universitätsklinik in Ulm. Veröffentlichungen: Geist im Netz
(Spektrum Akademischer Verlag,
1996); Musik im Kopf (Schattauer, 2002); Lernen. Gehirnforschung und die
Schule des
Lebens (Spektrum, 2002). E-Mail: manfred.spitzer@medizin.uni-ulm.de
©
17.02.2007
by Schlappy und Gipsy• ads-familie@gisu.de